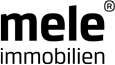Eigentümerversammlung – Ablauf und Abstimmung klar erklärt

Wer in einer Wohnungseigentümergemeinschaft lebt, trifft wichtige Entscheidungen nicht allein, sondern gemeinsam mit den anderen Eigentümern. Die Eigentümerversammlung ist das zentrale Organ, in dem verbindliche Beschlüsse zu Reparaturen, Modernisierungen, Hausordnung und Finanzen gefasst werden. Ablauf und Abstimmung in dieser Versammlung bestimmen, wie das Miteinander im Haus funktioniert.
Viele Eigentümer fragen sich, wie so eine Eigentümerversammlung eigentlich abläuft und wie das Abstimmungsrecht aussieht. Von der Einladung über die Tagesordnung bis zu den Abstimmungsarten gibt’s einiges zu beachten, damit am Ende alles mit rechten Dingen zugeht.
Suchen Sie einen zuverlässigen Hausverwalter in Berlin?
Zusammenfassung
- Die Eigentümerversammlung regelt die wichtigsten Entscheidungen der Gemeinschaft.
- Beschlussfähigkeit und Abstimmungen sind klar im Gesetz festgelegt.
- Verschiedene Abstimmungsarten sorgen für Transparenz und Fairness.
Grundlagen der Eigentümerversammlung
Die Eigentümerversammlung ist das Herzstück der Wohnungseigentümergemeinschaft. Die rechtlichen Grundlagen stehen im Wohnungseigentumsgesetz. Hausverwaltung und Gemeinschaft haben jeweils klar umrissene Aufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung.
Definition und Bedeutung
Die Eigentümerversammlung ist das wichtigste Treffen für alle Wohnungseigentümer einer Wohnanlage. Hier werden zentrale Entscheidungen zur Verwaltung des Gemeinschaftseigentums getroffen.
Themen wie Instandhaltung, Renovierung und das Hausgeld stehen oft auf der Tagesordnung. Die Beschlüsse sind für alle bindend, auch für Abwesende. Die meisten Entscheidungen fallen per Mehrheitsbeschluss.
Mindestens einmal pro Jahr muss so eine Versammlung stattfinden. Sie bringt die Eigentümer an einen Tisch und sorgt dafür, dass jeder bei wichtigen Fragen mitreden darf.
Rechtliche Grundlagen und Gesetzgebung
Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) bildet die gesetzliche Basis für die Eigentümerversammlung. Es schreibt vor, dass die Versammlung mindestens einmal im Jahr von der Hausverwaltung einberufen werden muss. Die Einladung muss schriftlich rausgehen und die Tagesordnung enthalten.
Wichtige Gesetze und Vorschriften:
- WEG §§ 23 bis 25 (versammlungsbezogene Regeln)
- Gemeinschaftsordnung (zusätzliche Regelungen der WEG)
Das Gesetz verlangt auch, dass jedes Beschlussergebnis schriftlich protokolliert wird. Rechte wie Stimmabgabe, Vollmachten und Einsicht in Protokolle sind klar geregelt. Wer mit einem Beschluss nicht einverstanden ist, kann vor Gericht gehen – zum Beispiel, wenn das Gesetz nicht eingehalten wurde.
Rolle von Wohnungseigentümergemeinschaft und Hausverwaltung
Die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) besteht aus allen Eigentümern eines Hauses. Sie entscheidet gemeinsam über Dinge wie Instandhaltung oder Finanzen.
Die Hausverwaltung organisiert die Versammlung, verschickt Einladungen und erstellt die Tagesordnung. Während der Versammlung führt sie meistens durch die Tagesordnung, prüft die Anwesenheit und hält die Beschlüsse fest. Später setzt sie die Entscheidungen um.
Eigentümer können Anträge stellen, Fragen einbringen oder sich vertreten lassen. Die Hausverwaltung muss neutral und im Interesse der Gemeinschaft handeln. Die genauen Aufgaben und Rechte sind in der Gemeinschaftsordnung und im WEG festgelegt.
Einberufung und Ablauf der Eigentümerversammlung
Eine Eigentümerversammlung ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Treffen der Wohnungseigentümer. Sie muss geplant, ordentlich eingeladen und dokumentiert werden, damit alle Beschlüsse wirksam sind.
Einladung und Fristen
Der Verwalter muss die Eigentümerversammlung mindestens einmal im Jahr einberufen. Die Einladung sollte jedem Eigentümer rechtzeitig, meistens mindestens drei Wochen vorher, zugehen.
Die Einladung kommt in Textform, also per Brief oder E-Mail. In dringenden Fällen kann’s auch mal schneller gehen – aber nur, wenn alle einverstanden sind. Die Einladung muss Namen, Anschrift, genaue Uhrzeit und Ort enthalten.
Wichtig ist, dass alle Tagesordnungspunkte aufgeführt sind. Nur über diese Punkte kann gültig abgestimmt werden. Wer nicht kommen kann, darf eine Vollmacht ausstellen.
Tagesordnung und Besprechungspunkte
Die Tagesordnung wird vom Verwalter oder der Hausverwaltung zusammengestellt. Sie enthält alle Themen, die in der Versammlung besprochen und entschieden werden sollen. Typische Themen: Jahresabrechnung, Hausgeld, Modernisierungen, Instandhaltung, Wahlen.
Jeder Eigentümer kann vorab beantragen, weitere Punkte aufzunehmen. Die Tagesordnung sollte so klar wie möglich sein, damit niemand überrascht wird. Änderungen während der Versammlung gehen nur, wenn alle Anwesenden zustimmen.
Beispiel für Tagesordnung:
- Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Genehmigung der letzten Niederschrift
- Beschluss über Instandhaltungsmaßnahmen
- Sonstiges
Durchführung und Protokoll
Die Versammlung startet mit der Eröffnung, Anwesenheitskontrolle und Feststellung der Beschlussfähigkeit – das macht entweder der Verwalter oder ein gewählter Versammlungsleiter.
Zu jedem Tagesordnungspunkt wird erst diskutiert, dann abgestimmt. Je nach Gemeinschaftsordnung zählt entweder jede Person gleich oder die Anteile entscheiden. Das Ergebnis wird direkt verkündet.
Alle Beschlüsse kommen ins Protokoll. Das muss vollständig und rechtssicher sein. Unterschrieben wird es vom Versammlungsleiter, einem Eigentümer und eventuell vom Verwaltungsbeirat. Jeder Eigentümer kann das Protokoll später einsehen.
Teilnahme und Vollmacht
Alle Mitglieder der Eigentümergemeinschaft dürfen an der Versammlung teilnehmen. Sie können ihr Stimmrecht selbst ausüben oder jemandem eine Vollmacht geben.
Die Vollmacht muss vor oder zu Beginn der Versammlung vorliegen, schriftlich oder in Textform. Oft vertreten Ehepartner, der Verwalter oder andere Eigentümer. Wie genau, steht meist in der Gemeinschaftsordnung.
Wer nicht selbst kommen kann, sollte eine vertraute Person beauftragen. Nur so bleibt das eigene Stimmrecht gewahrt.
Beschlussfähigkeit und Stimmrecht
Damit die Beschlüsse einer Eigentümerversammlung gültig sind, gibt es klare Regeln zur Beschlussfähigkeit und zum Stimmrecht. Besonders wichtig: Wie viele stimmberechtigte Eigentümer dabei sind und wie ihre Stimmen zählen.
Wann ist eine Eigentümerversammlung beschlussfähig?
Eine Eigentümerversammlung ist beschlussfähig, wenn bestimmte Bedingungen stimmen. Meist reicht es, wenn die anwesenden stimmberechtigten Eigentümer mindestens 50 % der gesamten Miteigentumsanteile vertreten.
So ist sichergestellt, dass nicht nur eine kleine Gruppe entscheidet.
In Ausnahmefällen – etwa nach einer Wiederholung – kann das Gesetz auch weniger verlangen. Die Teilungserklärung oder Hausordnung kann abweichende Regeln haben, die dann Vorrang haben.
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Vor der Sitzung prüft die Hausverwaltung oder der Versammlungsleiter, wer da ist und wie viele Anteile vertreten werden. Nur ordnungsgemäß eingeladene Eigentümer mit Anteilen dürfen abstimmen.
Die Zahl wird auf einer Anwesenheitsliste festgehalten, oft mit Vollmachten ergänzt. Das Ergebnis landet ins Protokoll, damit später klar ist, ob die Versammlung beschlussfähig war.
Erst nach dieser Prüfung starten die Abstimmungen. Bei Zweifeln kann jeder Eigentümer Einspruch erheben.
Stimmrechte und Prinzipien (Kopf-, Wert-, Objektprinzip)
Das Stimmrecht regelt, wie viel Einfluss ein Eigentümer bei Abstimmungen hat. Es gibt drei gängige Prinzipien:
- Kopfprinzip: Jede Person, egal wie groß der Miteigentumsanteil, hat eine Stimme.
- Wertprinzip: Die Stimmen richten sich nach dem Wert oder der Größe des Miteigentumsanteils; je mehr Anteile, desto mehr Stimmgewicht.
- Objektprinzip: Jede Einheit (Wohnung oder Objekt) zählt als eine Stimme, unabhängig vom Wert.
Meist ist das Wertprinzip Standard, wenn nichts anderes festgelegt wurde. Bei neueren Gesetzen gibt’s auch Mischformen, zum Beispiel zwei Drittel der abgegebenen Stimmen, aber mindestens ein Drittel der Gesamtanteile.
Wie genau abgestimmt wird, steht in der Teilungserklärung oder Gemeinschaftsordnung der Eigentümergemeinschaft.
Abstimmungsarten und Mehrheiten
Welche Mehrheit in einer Eigentümerversammlung nötig ist, hängt immer vom Thema ab. Da gibt’s unterschiedliche Mehrheitsformen und spezielle Regeln, gerade bei größeren Bauprojekten oder weitreichenden Entscheidungen.
Formen der Mehrheiten und deren Bedeutung
In der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) begegnet man verschiedenen Mehrheiten. Welche gebraucht wird, richtet sich nach dem Gegenstand der Abstimmung und was das Gesetz dazu sagt.
Häufige Formen der Mehrheit sind:
| Mehrheitsform | Bedeutung |
|---|---|
| Einfache Mehrheit | Mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen |
| Qualifizierte Mehrheit | Meistens zwei Drittel oder drei Viertel |
| Allstimmigkeit | Alle Stimmen der stimmberechtigten Eigentümer |
Die einfache Mehrheit reicht für viele Entscheidungen aus. Bei wichtigen Angelegenheiten, etwa baulichen Veränderungen, ist oft eine qualifizierte Mehrheit oder sogar Allstimmigkeit nötig. Wie viele Stimmen jeder Eigentümer hat, hängt davon ab, ob das Kopfprinzip, Wertprinzip oder Objektprinzip gilt.
Einfache und qualifizierte Mehrheit
Einfache Mehrheit: Mehr als die Hälfte der anwesenden oder vertretenen Eigentümer stimmt zu. Meist zählt jede Stimme gleich (Kopfprinzip). Das gilt für die meisten Beschlüsse rund ums Gemeinschaftseigentum.
Beispiel: Bei 10 anwesenden Eigentümern genügen 6 Stimmen für eine einfache Mehrheit.
Qualifizierte Mehrheit: Für größere Maßnahmen – Modernisierungen oder wichtige Vertragsänderungen – braucht’s mehr als nur eine einfache Mehrheit. Meist sind 2/3 oder 3/4 der Stimmen nötig. Was genau verlangt wird, steht entweder in der Gemeinschaftsordnung oder ist gesetzlich festgelegt.
Tabelle:
| Maßnahme | Erforderliche Mehrheit |
|---|---|
| Haushaltsplan, Instandhaltung | Einfache Mehrheit |
| Modernisierung, große Änderungen | Qualifizierte Mehrheit |
Sonderfälle: Bauliche Veränderungen und Allstimmigkeit
Bei baulichen Veränderungen wie Anbauten, Aufzügen oder neuen Balkonen gelten strengere Regeln. Häufig ist hier eine qualifizierte Mehrheit (zum Beispiel 3/4) oder sogar die Zustimmung aller Eigentümer gefragt.
Allstimmigkeit heißt: Jeder stimmberechtigte Eigentümer muss zustimmen. Fehlt auch nur eine Stimme, scheitert der Beschluss.
Allstimmigkeit ist vor allem dann Pflicht, wenn Rechte einzelner Eigentümer durch die bauliche Veränderung berührt werden. Auch bei Änderungen der Teilungserklärung oder der Eigentümerstruktur kann sie verlangt sein. Es lohnt sich also, vorher zu prüfen, welche Mehrheit gebraucht wird.
Stimmabgabe und Ablauf der Abstimmung
Die Abstimmung auf einer Eigentümerversammlung läuft nach festen Regeln ab, damit alles fair und nachvollziehbar bleibt. Wer wie viele Stimmen hat, wie abgestimmt wird und welche Rolle Vertreter spielen, ist für das Ergebnis entscheidend.
Abstimmungsprozess und Protokollierung
Zu Beginn liest der Versammlungsleiter den Beschlussantrag vor. Die Abstimmung selbst findet meist offen per Handzeichen statt. Es kann aber auch geheim abgestimmt werden, wenn die Versammlung das beschließt.
Alle Stimmen werden im Protokoll genau festgehalten. Das Protokoll sollte enthalten:
- Anzahl Ja-Stimmen
- Anzahl Nein-Stimmen
- Anzahl der Enthaltungen
- Abstimmungsergebnis
Der Versammlungsleiter stellt das Ergebnis fest und verkündet es mündlich. Abgegebene Stimmen können nach Zugang beim Leiter nicht mehr widerrufen werden.
Stimmgewicht und Enthaltungen
Das Stimmgewicht variiert. Oft zählt jede Wohnung eine Stimme (Kopfprinzip), manchmal richtet sich das Stimmrecht aber nach den Miteigentumsanteilen. Die Details stehen in der Gemeinschaftsordnung.
Beispiel für Stimmenzählung
| Eigentümer | Stimmen | Miteigentumsanteile |
|---|---|---|
| Frau Müller | 1 | 100/1000 |
| Herr Schmidt | 1 | 200/1000 |
| Frau Becker | 1 | 700/1000 |
Enthaltungen werden nicht zur Mehrheit gezählt – sie gelten weder als Ja noch als Nein. Gezählt werden nur die abgegebenen Ja- und Nein-Stimmen.
Stimmabgabe durch Vertreter oder mehrere Stimmen
Eigentümer können ihr Stimmrecht oft auch durch einen Vertreter ausüben, zum Beispiel ein Familienmitglied. Die Vollmacht dazu muss normalerweise schriftlich und rechtzeitig vorliegen.
Wer mehrere Wohnungen besitzt, hat auch mehrere Stimmen – besonders, wenn nach Miteigentumsanteilen abgestimmt wird. Dabei sollte klar sein, wie viele Stimmen tatsächlich vertreten werden.
Vertretene Stimmen sollten im Protokoll extra gekennzeichnet sein. Das macht alles nachvollziehbarer und beugt Streit vor. Vor Beginn der Abstimmung wird meist geprüft, ob die Vertretungsberechtigungen stimmen.
Typische Beschlüsse und Anfechtung
In der Eigentümerversammlung fallen viele wichtige Entscheidungen. Meist geht’s um den Wirtschaftsplan, das Hausgeld oder Verwaltungsfragen. Für alle Beschlüsse gibt es klare Regeln – und sie können unter bestimmten Voraussetzungen angefochten werden.
Übliche Beschlussfassungen (Wirtschaftsplan, Hausgeld, Verwaltung)
Typische Beschlüsse betreffen den Wirtschaftsplan, das Hausgeld oder die Bestellung und Abberufung der Verwaltung. Über diese Punkte wird laut § 25 Abs. 1 WEG regelmäßig abgestimmt.
Im Wirtschaftsplan werden die geschätzten Kosten auf die Eigentümer verteilt. Das Hausgeld ergibt sich daraus. Auch Veränderungen beim Verwalter oder größere Gemeinschaftsmaßnahmen brauchen einen Beschluss der Versammlung.
Bauliche Veränderungen oder Modernisierungen brauchen ebenfalls einen förmlichen Beschluss. Im Protokoll der Versammlung werden alle Entscheidungen festgehalten.
Gültigkeit und Anfechtung von Beschlüssen
Beschlüsse aus der Eigentümerversammlung sind erst mal gültig. Wer meint, dass sie gegen Gesetze oder die Gemeinschaftsregeln verstoßen, kann sie anfechten – und zwar beim zuständigen Amtsgericht.
Ein Eigentümer kann anfechten, wenn zum Beispiel die Einladung nicht richtig war, der Beschlussinhalt fehlerhaft ist oder bei der Abstimmung Formfehler passiert sind. Die Anfechtung sorgt dafür, dass unzulässige oder nachteilige Entscheidungen überprüft und eventuell aufgehoben werden.
Solange kein Gericht etwas anderes entscheidet, bleiben die Beschlüsse in Kraft.
Fristen und Besonderheiten (§ 24, § 25 WEG)
Die wichtigsten Fristen stehen in § 24 und § 25 WEG. Die Klage zur Anfechtung muss spätestens einen Monat nach der Beschlussfassung eingereicht werden. Wer anfechten will, sollte diese Frist unbedingt im Blick behalten.
Die Klagebegründung kann innerhalb eines weiteren Monats nachgereicht werden – das läuft normalerweise schriftlich beim Amtsgericht. Kurz vor Ablauf der Frist sollte man sich nochmal überlegen, ob eine Klage wirklich nötig ist.
Alle Infos zur Versammlung und zum Ablauf sollten gut dokumentiert sein. Wird nicht rechtzeitig angefochten, bleiben die Beschlüsse verbindlich.
Häufig gestellte Fragen zur Abstimmung der Eigentümerversammlung

Sabine Schulz Qualifizierte Immobilienverwalterin / Immobilienkauffrau
Ihr Ansprechpartner für die Geschäftskundenbereiche:
Mietenverwaltung / Personal
Telefon: 03976-43 42 06